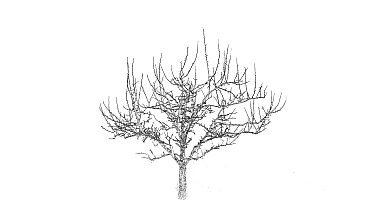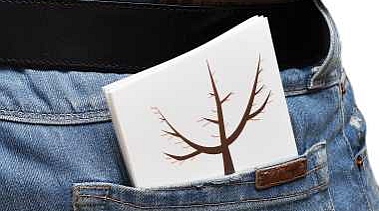![]()

Obstbaumschnitt, Baumpflege, Schnittkurse, Pflanzenschutz in Tübingen und Umgebung – Baumpflege Rickmer Stohp. Fotos (3): Johannes Zabka.
Baumschnitt und Baumpflege Tübingen
Die Baumpflege Tübingen bietet das komplette Spektrum rund um den Schnitt und die Pflege von Bäumen, speziell von Obstbäumen.
Seit mehr als 25 Jahren schneide ich Obstbäume nach der Öschberg-Palmer-Methode. Der Öschbergschnitt, benannt nach der Kantonalen Obst- und Gartenbauschule Öschberg in der Schweiz, wo diese Baumschnittmethode Ende der 1920er-Jahre von Karl Spreng erstmals angewendet wurde, zielt bei Hoch- und Halbstämmen darauf ab, eine besonders große Krone zu erzielen. Anders als eine Baumkrone, die mit dem klassischen Pyramidenschnitt geschnitten wurde, öffnet sich die Öschbergkrone trichterförmig zum Licht hin – die Voraussetzung für eine optimale Reifung der Früchte. Der Öschbergschnitt, der von dem „Remstalrebellen“ Helmut Palmer in den 1950er-Jahren in Deutschland eingeführt und weiterentwickelt wurde, zeichnet sich daher durch höhere Erträge bei gleichzeitig geringerem Pflege- und Schnittaufwand aus.
Kurse Öschberg-Palmer-Baumschnitt
Sie möchten Ihre Obstbäume selbst schneiden und den Öschberg-Palmer-Schnitt erlernen? In ein- oder zweitägigen Baumschnittkursen vermittele ich alle erforderlichen Grundlagen dieser naturgemäßen und einfach zu erlernenden Schnittmethode. Meine Kurse richten sich besonders an Garten- und Streuobstwiesenbesitzer, die über keine bzw. wenig Erfahrung im Schnitt von Obstbäumen verfügen.
Die Kurse beinhalten einen umfangreichen Praxisteil; die Teilnehmer haben also viel Zeit für Eigenarbeit.
Interessiert? Dann können Sie wählen zwischen Kursen zu feststehenden Terminen (maximal 12 Teilnehmer) und privaten Kursen an Ihren eigenen Bäumen.
Meine Baumschnittkurse finden vorzugsweise in der vegetationslosen Phase statt, also in der von November bis März.

![]()
Meine Leistungen
Baumpflege
• Jungbaumpflege
• Totholzentfernung
• Kronenpflegemaßnahmen
• Entlastung / Auslichtung / Einkürzung
Pflanzenschutz
• Nützlingsförderung
• Bodenproben
• Düngung
• Schädlingsbekämpfung
Artenschutz
• Wiesenmahd
![]()
![]()
![]()
Kontakt aufnehmen